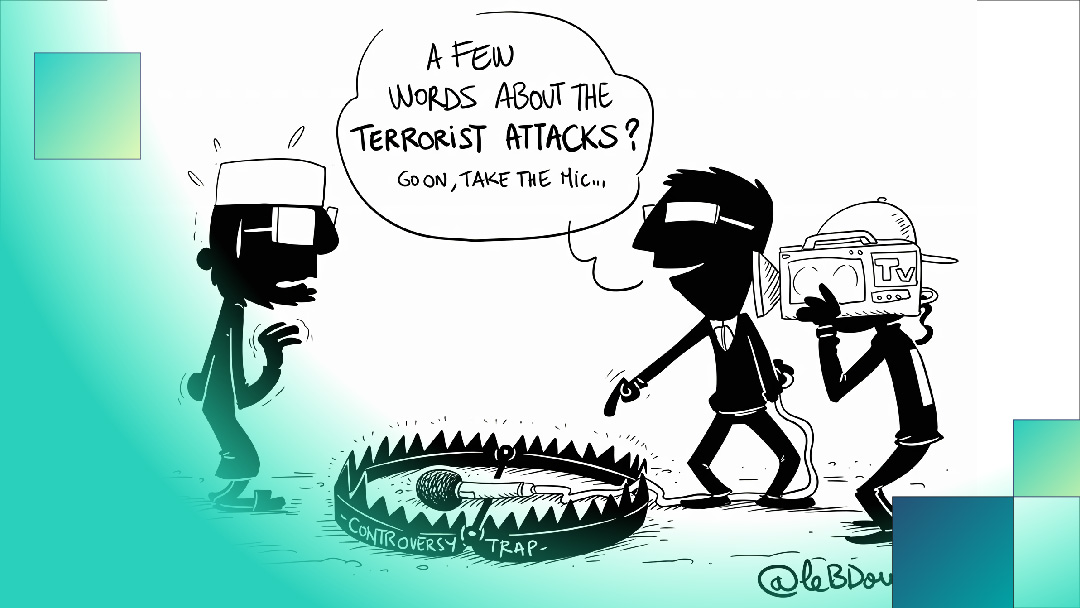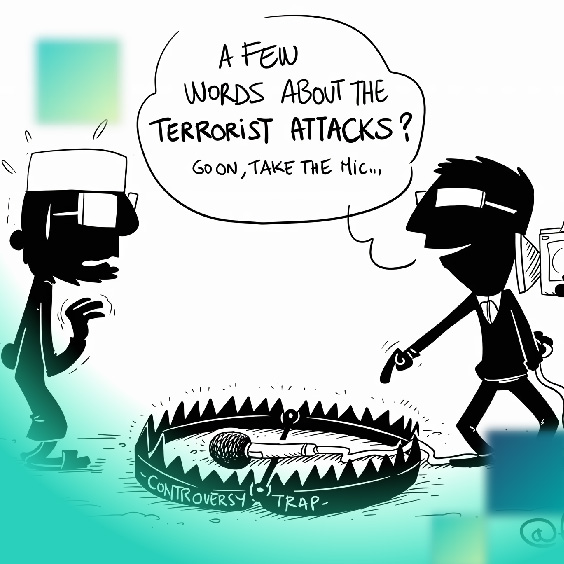| Von Abdel Azziz Qaasim Illi | @qaasimilli folgen |
Die Szenen der Gewalt in Paris sind vorüber. Am zweiten Tag nach dem blutigen Ende eines der wohl meistbeachteten Gewaltakte in der jüngeren Mediengeschichte herrscht zunehmend Klarheit darüber, was sich seit Mittwoch in Frankreichs Hauptstadt und Umgebung zugetragen hat.
Das junge muslimische Brüderpaar Saïd und Chérif Kouachi mit algerischen Wurzeln und französischem Pass griff zu den Waffen und tötete alle anwesenden Redaktionsmitglieder von Charlie Hebdo. Ziel der Aktion sei es gewesen, den Propheten Muhammad (saws) im Nachgang an die provokative Publikation der Karikaturen zu rächen. Nach eigenen Angaben, seien die Brüder im Auftrag des jemenitischen Ablegers «der Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel» (AQAP) unterwegs gewesen. Dieses Selbstzeugnis erfuhr nach der gestrigen Publikation einer Audiobotschaft von Shaykh Harith an-Nathari, dem bekannten Pressesprecher der AQAP zusätzliche Glaubwürdigkeit. An-Nathari lobte die Angreifer als «Schar der muslimischen Soldaten», nannte die Verteidigung des Propheten einleitend als Motiv und schwenkte dann aber interessanterweise gegen Ende über zu einem zweiten wenig beachteten Motiv: dem westlichen Interventionismus in der islamischen Welt.
«Oh ihr Franzosen, es wäre besser für euch, wenn ihr eure Aggressionen gegen die Muslime aufgeben würdet, vielleicht könntet ihr dann in Frieden leben. Doch wenn ihr alles ablehnt ausser den Krieg, dann erfreut euch, ob der Nachricht, dass [auch] euch keine Sicherheit gewährt sein soll, so lange ihr Krieg gegen Allah und seinen Gesandten führt und die Gläubigen bekämpft. ‚Sprich zu denen, die ungläubig sind, dass ihnen das Vergangene verziehen wird, wenn sie absehen; kehren sie aber zurück, dann wahrlich, ist das Beispiel der Früheren schon dagewesen.’ [HQ, 8,38].»
Der dritte scheinbar aus dem Nichts auftauchende Attentäter Amedy Coulibaly tötete am Donnerstag nach dem Angriff auf Charlie Hebdo eine Polizistin und verschwand dann von der Bildfläche, bis er am Freitagmittag mit der Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt wieder auf sich aufmerksam machte. Anders als die Brüder Kouachi gab Coulibaly an, im Namen des «Islamischen Staats» (IS) zu agieren. Gemäss einer durch den französischen TV-Sender BFMTV mitgeschnittenen Unterhaltung mit seinen Geiseln, soll er sein Motiv wie folgt erklärt haben:
«Ich denke an jene, die sich mit Bashar al-Asad in Syrien schlagen mussten. Er folterte Menschen. Niemand tat etwas über die Jahre hinweg. Dann Luftangriffe, Koalition von 50 Ländern und all das. Wieso tun sie dies? Da waren Nord-Mali und Syrien. Die müssen aufhören, den «Islamischen Staat» zu attackieren und uns zu zwingen, unsere Frauen zu entschleiern sowie unsere Brüder für nichts in Gefängnisse zu sperren.»
Der oft bemühte Topos, die Attentäter hätten einen Angriff auf die Meinungsäusserungsfreiheit durchgeführt, macht aus der Opferperspektive heraus betrachtet sicherlich Sinn. Voraussichtlich wird der Angriff eine gewisse Vorsicht im Umgang mit hochsensiblen Objekten muslimischer Verehrung nach sich ziehen, wenn sich die emotionale Gruppendynamik trotziger öffentlicher Figuren einmal wieder gelegt hat. Man kann dazu stehen wie man will – ich z.B. finde die Entwicklung extrem beängstigend – aber eine Abwägung, ob eine beleidigend wirkende Provokation gegen eine diskursiv schwach bis unbewehrte Minderheit in einem stets instabiler werdenden sozio-politischen Gefüge sinnvolle Resultate liefert, muss jeder Verleger in Zukunft auch vor dem Hintergrund dieser Bluttat in gebührender Verantwortung vornehmen. Die dänische Jyllands-Posten hat die Konsequenzen gezogen und auf den Abdruck weiterer Karikaturen zum Entsetzen vieler Konkurrenten verzichtet.
Das Attentat von Paris hat uns allen noch einmal klar gemacht, dass die Meinungsäusserungsfreiheit eben doch ihre Grenzen hat. Wo die Grenzen gezogen werden, verhandelte in westlich-modernen Gesellschaften bisher primär der öffentliche Diskurs. Darum ist es auch kein Wunder, dass Witze genauso wie ernster gemeinte textuelle Erzeugnisse gegen Muslime in vielen Fällen von der Meinungsäusserungsfreiheit geschützt werden, während Vergleichbares gegen Juden sofort einen Aufschrei auslösen würde. Dieser potentielle Aufschrei schwebt wie ein zensurübendes Damoklesschwert über jedem Autoren und Karikaturisten. Freilich war das nicht immer so. Im Europa des 19. Jh. war das Karikieren der Juden zu einem publizistischen Kampfmittel avanciert, um die Leserschaft an die vermeintliche Gefahr einer wirtschaftlich wie kulturellen Machtübernahme durch das Judentum zu erinnern.
Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der Shoa haben es die Juden dann aber verstanden, durch geschicktes Lobbying und eine diplomatisch nahezu perfekte Ausrichtung der israelischen Aussenpolitik, die bisher gültigen Diskursgrenzen zu ihrem Schutz und Nutzen zu verschieben. Heute üben die meisten Autoren willig oder widerwillig sogar dann Selbstzensur, wenn es darum ginge, die Verbrechen des israelischen Staates anzuprangern. Man kann also sagen, dass die Juden einen eindrücklichen Wandel von diskursiv unbewehrten Objekten hin zu schwerbewehrten Diskursteilnehmern vollzogen haben.
Von einem ähnlichen Szenario träumen heute wohl viele Muslime. Mehr als ein Traum dürfte es aus hier nicht weiter zu thematisierenden Gründen in absehbarer Zukunft nicht werden. Muslime sind in der aktuellen Realität dem übermächtigen öffentlichen Diskurs in Europa ausgeliefert und sie verfügen über keinen eigenständigen institutionellen Pol, der in der Lage wäre, auf Augenhöhe (bewehrt) am Diskurs teilzunehmen, d.h. auch bei der Ausgestaltung der normativen Korridore (Diskursgrenzen) gewichtig mitzureden.
Aus muslimischer Sicht wird die Meinungsäusserungsfreiheit seit sie für Muslime überhaupt eine Rolle spielt vor allem als ein gewährter und vordefinierter westlich-moderner Wert empfunden. Er gilt immer dann absolut, wenn es darum geht, westlich-moderne Interessen diskursiv durchzusetzen, stösst aber sofort an seine Grenzen, wenn unbewehrte Diskursteilnehmer ihn in ihrem Kampf etwa um Freiheit und Gerechtigkeit in Anspruch nehmen wollen. In Frankreich hat sich dieses Grundmuster im vergangen Sommer z.B. anhand eines Verbots pro-palästinensischer Kundgebungen manifestiert, während die heutzutage eher pro-israelischen Medien die Hauptschuld am Krieg in Gaza der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas zugeschrieben haben. Weitere Beispiele, die diese Disparität bei den Grenzen der Meinungsäusserungsfreiheit verdeutlichen, folgen weiter unten bei der Frage, wieso heute anti-westliche Ressentiments zunehmend in Gewalt umschlagen.
Vielen Muslimen erscheint die heute postulierte Meinungsäusserungsfreiheit als ein für sie je nach Kontext ganz oder teilweise unzugängliches Privileg westlich-moderner Machtpole, welches zudem in vielen Fällen als Waffe gegen ihre Identität zur Anwendung kommt. Wie viele unter ihnen etwa in Algerien, Palästina oder jüngst Ägypten, die an eine unparteiische Meinungsäusserungsfreiheit geglaubt hatten, wurden schon bitter enttäuscht?
Woher kommt das Ressentiment gegen den Westen?
Als die Trümmer der Zwillingstürme in New York am 11. September noch dampften, sprach George W. Bush bereits über die Motive der noch unbekannten Täterschaft. Ziel sei nicht die USA, sondern die Freiheit der westlichen Welt. Letztlich gehe es den Tätern darum, die Freiheit zu vernichten, weil sie jene hassten. Gerade diese Tage lesen wir wieder viel und oft, Aussagen von Politikern, die in dieselbe Richtung schlagen. Bundesrat Ueli Maurer etwa meint im Sonntagsblick von heute: «Es ist ein Fakt, dass viele Anschläge in jüngster Zeit im Namen des Islam passierten. Die Frage, welches der richtige Gott sei, scheint im 21. Jahrhundert zu fürchterlichen Konflikten zu führen.» Der Schweizer Verteidigungsminister geht also davon aus, dass islamisch begründete Anschläge das Fanal eines Religionskriegs um die Frage und Durchsetzung einer transzendentalen Wahrheit sei.
Es macht den Anschein, dass versucht wird, die Motive der Attentäter partout mittels abstrakten Behauptungen unter den Tisch zu wischen, vielleicht um nicht auf sie eingehen zu müssen. Dabei sind sie doch wie eingangs besprochen gerade auch in diesem Fall selbst bezeugt und inhaltlich identisch mit jenen früheren muslimischen Attentätern wie etwa Mohammed Merah. Von einem Kampf gegen Freiheiten ist dabei nie die Rede. Dafür wird angegeben, für die Freiheit etwa des palästinensischen Volkes von der israelischen Besatzung oder für die Freiheit der Syrer vom Regime des Tyrannen Bashar al-Asad zu kämpfen.
Die Attentäter sind in ihrer Selbstauslegung Freiheitskämpfer und keine Terroristen. Sie lehnen sich gegen die militärisch Verbündeten Israels und der USA auf, welche in der islamischen Welt etwa den gleich negativen Ruf haben wie Terroristen. Andere westliche Länder – Frankreich allen voran – haben sich in jüngster Zeit durch vermehrte Kooperation mit Israel und den USA viel Kredit und Glaubwürdigkeit in der islamischen Wahrnehmung verspielt. «Der Westen» hat es mit seiner über Jahrzehnte hinweg einseitigen Parteinahme für Israel, dem Einmarsch in Afghanistan 2001 und Irak 2003 sowie den bis heute anhaltenden Drohungen gegen den Iran zustande gebracht, die im Zuge der Dekolonisierung postulierte Selbstbestimmung der Völker als Farce zu enttarnen. Zwar wurden die muslimischen Kolonien in eine vom Westen eng umgrenzte nationale Unabhängigkeit entlassen, viel Spielraum für eine indigene Ausformung politischer Systeme und kultureller Identitäten blieb aber in den vorgegebenen normativen Korridoren der ehemaligen Kolonialmächte nicht.
Muslimische Staaten hatten sich jeweils den politischen Vorgaben ihrer ehemaligen Mutterländer zu fügen sowie dem nunmehr zur universalen Normativität ausgerufenen Wertekonsens des Westens. Die nach 1945 erschaffene neue Weltordnung unter Oberaufsicht des UN-Sicherheitsrates ist ein Spiegel dieses westlichen Mächtekonzerts am Ende des Zweiten Weltkriegs. Grosse Teile der islamischen Welt waren damals noch kolonisiert und hatten keinerlei Mitsprache bei der Konstruktion jener Normen, die heute als universal gültig erklärt und deren weltweite Durchsetzung immer wieder auch mittels Sanktionen und Krieg erzwungen werden.
Frankreich entsandte seit 2001 rund 4000 Soldaten nach Afghanistan, um sich an der US-geführten und durch den UN-Sicherheitsrat abgesegneten Operation «Enduring Freedom» zu beteiligen. Ziel war es die seit 1996 herrschenden Taliban zu stürzen und im Anschluss eine Demokratie nach westlichem Zuschnitt einzupflanzen. Der Hass der islamischen Kämpfer in Afghanistan auf Frankreich hielt sich derweil in überschaubarem Rahmen, war der Krieg doch sowohl medial wie personell eindeutig ein US-amerikanischer. Die konsequente Zurückhaltung im Irakkrieg 2003 ersparte Frankreich Anschläge mit islamischem Hintergrund, während in Madrid (2004) und London (2005) Bomben ein Blutbad anrichteten.
Derweil erregte Frankreichs Innenpolitik die Gemüter der islamischen Welt. 2004 glaubte Frankreich seine Laïcité-Staatsdoktrin von 1905 wieder einmal aktualisieren zu müssen. Als im Februar die Nationalversammlung ein Verbot religiöser Bekleidung in öffentlichen Schulen verfügte, Kreuzchen und Davidsterne aber davon ausnahm, lagen die Nerven unter französischen Muslimen blank. Weltweit stiess der Eingriff in die Religionsfreiheit an der muslimischen Basis auf Kritik. Um die Wogen zu glätten, setzte Nicolas Sarkozy auf den unter seinem Patronat 2003 gegründeten «Conseil français du culte musulman» (CFCM), dessen Vertreter zusammen mit dem damaligen Sheikh al Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi, in einer für die Basis bis heute unverstandenen und theologisch zweifelhaften Konstruktion behaupteten, dass die Hijab-Pflicht angesichts eines Verbots hinfällig werde.
Regierungsnahe Institutionen wie der CFCM, «dessen Mitarbeit die Integration oder eher noch die Assimilierung in die Richtung eines oft herbeigewünschten Islams à la française erleichtern sollte», schiessen seit einigen Jahren europaweit wie Pilze aus dem Boden. Verunsicherte Regierungen suchen nach muslimischen Repräsentanten, welche bereit sind, das jeweilige kultur-politische Programm in die religiöse Sprache zu übersetzen – sprich als Marionetten des Diskurses zumindest dem Anschein nach die Muslime gegenüber dem Staat zu vertreten. «Tatsache ist, dass dieser CFCM von der heterogenen muslimischen Bevölkerung kaum als repräsentative Autorität anerkannt wird», schreibt Rudolf Balmer heute in der NZZ am Sonntag in seinem lesenswerten Artikel mit der Überschrift «Die Ghetto-Religion».
Gerade zugewanderte Muslime kennen das im Kolonialismus oft bemühte Prinzip des «divide et impera» nur zu gut. Auch damals in Algerien wurden Institutionen wie etwa die «Bureaux arabes» geschaffen, mit dem Ziel die arabo-islamische Kultur intellektuell zu durchdringen sowie anschliessend loyale Kollaborationseliten zu identifizieren und zu rekrutieren. Dass auch heute wieder auf solche Institutionen gesetzt wird, erstaunt ob der kulturimperialistischen Politik der Franzosen nicht. Damals wie heute ist man bestrebt die Muslime nach dem Massstab der eigenen Werte zu erziehen oder wie es einst hiess zu «zivilisieren».
In diesem Sinne verstanden viele Muslime auch die Einführung des von Nicolas Sarkozy angestrebten Niqab-Verbots im September 2010 durch die Nationalversammlung. Muslimische Frauen sollten fortan nicht mehr die Freiheit haben, ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zu bedecken. Was von einer Mehrheit der nicht-muslimischen Franzosen als Befreiung der muslimischen Frau gefeiert wurde, löste unter betroffenen Musliminnen starke Ressentiments aus. Überhaupt empfanden die Muslime Sarkozys 2009 lancierte Debatte um die «nationale Identität» als einen gegen sie gerichteten kulturellen Affront.
Diese Debatte unter der Präsidentschaft Sarkozys schürte die Islamophobie in bisher nicht gekanntem Ausmass und vertiefte den gesellschaftlichen Graben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen weiter. Als 2012 Mohammed Merah im südlichen Toulouse seine Attentate gegen Soldaten und jüdische Ziele verübte, nannte er gemäss Staatsanwalt Francois Molins das Schicksal der Palästinenser, den Krieg in Afghanistan sowie das Niqab-Verbot als Motive für seine Tat.
Als François Hollande 2013 gegen islamische Gruppen in Nord-Mali den Krieg ausrief, war Frankreichs Ruf im muslimischen Bewusstsein längst ruiniert. Die innenpolitische Intoleranz hat das Klima nachhaltig vergiftet. In einem jüngst erschienenen Propaganda-Video des «Islamischen Staats» riefen drei französische Mitglieder der Organisation zum Kleinkrieg gegen das Land auf. Als Motiv führten sie neben dem jüngsten Krieg gegen Ziele der Gruppe in Syrien und im Irak auch wieder das Niqab-Verbot an.
Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass sich die Motive anders als im öffentlichen Diskurs dargestellt, im Wesentlichen auf zwei Pole hin ausrichten:
(A) Aussenpolitischer militärischer Interventionismus gegen islamische Bewegungen in der muslimischen Welt zugunsten des Erhalts der postkolonialen Ordnung sowie die Parteinahme für Israel
(B) Innenpolitisch zunehmend als Unterdrückung empfundene strukturelle Islamophobie wie etwa das Kopftuch- oder Niqab-Verbot
Ein modernes Problem der Hermeneutik
Wenn bisher vor allem in Linken Kreisen dem Islam eine Mitschuld an solchen Attentaten abgesprochen wurde, so setzt sich vor dem Hintergrund der jüngsten Vorkommnisse in Paris allmählich ein anderes Verständnis durch. Immer öfters hört man die Behauptung, die islamischen Quellen an sich böten die Grundlagen für eine Legitimation physischer Gewalt.
Dass der Islam keine auf Kultushandlungen beschränkte Religion wie etwa das moderne Christentum ist, sondern auch juristische und staatsrechtliche Normen vorgibt, hat sich längst herumgesprochen. Tatsächlich kennt der Islam auch ein detailreiches Kriegsrecht, welches die Anwendung physischer Gewalt etwa zur Abwendung von Schaden durch einen Feind vorsieht und legitimiert.
Über die Jahrhunderte hinweg führte dies auch nicht zu besonderen Problemen, denn das Gewaltmonopol lag ausschliesslich beim islamischen Staat. Kein osmanischer Muslim wäre auf die Idee gekommen, gegen Habsburg einen individuellen Kleinkrieg à la Saïd und Chérif Kouachi anzuzetteln, weil er sich oder seine Gemeinschaft durch das Hause Habsburg bedroht gefühlt hätte. Zuständig für die Sicherheit der muslimischen Osmanen war nämlich der Sultan und über den rechtlichen Rahmen, in dem sich jener bewegen konnte, wachte zumindest in der Theorie der Şeyh-ül islam. Selbst die muslimischen Korsaren, welche in der Frühen Neuzeit die Küsten der Mittelmeeranrainer unsicher machten, handelten fast immer mit der zumindest impliziten Zustimmung einer staatlichen Macht.
Der Zerfall islamischer Staatsstrukturen gefolgt vom Übergang zum modernen Nationalstaat führte auch schrittweise zur Untergrabung der staatlichen Deutungshoheit über das Religiöse. Zwar gibt es in allen muslimischen Ländern bis heute die Institution des Muftis, eines obersten Imams, der bei der Auslegung islamischer Quellen das letzte Wort haben sollte. Die Realität sieht aber anders aus. Die Moderne mit ihrem radikalen Individualismus, d.h. der so zentralen Subjektivität hat sich in hermeneutischer Hinsicht auch zum islamischen Denken Zutritt verschafft. Moderne Kommunikation und soziale Medien eröffnen zudem jedem Muslim – theologisch kompetent oder nur rhetorisch begabt – seine Interpretationsvorlagen einem beliebig breiten Publikum vorzutragen. Selbst rigide Zensurstaaten wie Saudi-Arabien haben den Kampf gegen die Demokratisierung der religiösen Interpretation längst verloren.
Wenn es um die Anwendung von Gewalt im Rahmen des islamischen Jihads geht, haben sich mittlerweile neue Autoritäten allen voran Al-Qaida herausgebildet, deren Akteure nicht mehr an staatliche oder internationale Verpflichtungen gebunden sind. Ihre Akteure sind wie der Tod Osama bin Ladins gezeigt hat, ohne Schaden austauschbar. Legitimation ziehen jene neuen Autoritäten aus ihrer Kritik an den Missständen innerhalb der muslimischen Staaten. Ihr erklärtes Ziel ist eigentlich gar nicht die Terrorisierung des Westens, sondern der Sturz korrupter Regime in der muslimischen Welt. Ihre Ideen sind heute überall dort präsent, wo eine Gruppe Muslime sich entscheidet, gegen eine unterdrückerische staatliche Macht den asymmetrischen Kampf aufzunehmen. Fatwas und Meinungen, Distanzierungen und Verurteilungen von staatlich gebundenen religiösen Autoritäten beeindrucken die Sympathisanten von Al-Qaida und Co. in etwa gleichermassen wie einen Freidenker die Bulle eines Papstes.
Die Frage, welche Wirkung die Präsenz eines stabilen und eigenständigen islamischen Staates auf Jihad-Kämpfer der Moderne hätte, bleibt vorläufig unbeantwortet. Jedoch erscheint es durchaus als möglich, dass ein potenter, in der Weltgemeinschaft respektierter islamischer Staat, der sich wie heute Israel für Juden als Schutzherr für muslimische Anliegen weltweit einsetzt, eine starke kohäsive Wirkung hinsichtlich des jihadistischen Gewaltmonopols entfalten könnte.
Darüber hinaus dürfte die Problematik der durch die westliche Moderne demokratisierten Hermeneutik auch in einem islamischen Staat nicht mehr verschwinden. Vor diesem Hintergrund wirkt die oft gehörte Einschätzung, Attentäter würden den Islam falsch oder gar nicht verstehen, einigermassen antimodern, lehrt doch die Moderne gerade den Respekt vor hermeneutischer Pluralität – auch dann wenn man mit der Sichtweise des anderen nicht einverstanden ist.
Dies soll nicht als Aufwertung der jihadistischen Hermeneutik gedeutet werden, sondern lediglich zum Ausdruck bringen, dass erst die westliche Moderne, den Weg in die subjektive Exegese geebnet hat.
Ob die staatliche Zertifizierung von Imamen und Predigern wie dies in der Schweiz nicht nur Lukas Reimann (SVP), sondern auch der neue Assimilationshelfer Mustafa Memeti fordern – der von der TA-Media nicht nur zum «Schweizer des Jahres» geadelt wurde, sondern als perfekt tanzende Marionette wohl bestqualifizier Prätendent für ein mögliches zukünftiges Obermufti-Amt ist – derweil eine politische Mehrheit findet, erscheint ob der Tendenz zu Deregulierung religiöser Verstrickungen des Staates eher unwahrscheinlich. Sicher ist, dass eine solche Regelung nicht mehr als eine weitere Sinnentleerung der Moschee zur Folge hätte. Welche Konsequenzen für die Autorität lokaler Imame eine staatliche Zwangspartnerschaft haben kann, beobachtet man derzeit in Ägypten, wo die vom staatlichen Waqf diktierten Predigten und Rechtsgutachten kaum mehr jemand ernst nimmt.
Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass ein Mehr an Sicherheit weder bei der staatlichen Intervention in der Moschee, noch bei blosser nachrichtendienstlicher Repression zu suchen ist. Letztere mag in einigen Fällen präventive Wirkung entfalten, kann jedoch wie das Beispiel der Boston-Attentate zeigte, selbst dann keine umfängliche Sicherheit bieten, wenn damit die Aushebelung einer Vielzahl von Bürgerrechten einhergeht.
Viel effizienter wäre es, die Muslime unter Respektierung ihrer islamischen Normen in der Gesellschaft endlich willkommen zu heissen, damit verbunden einen glaubwürdigen Kampf gegen Islamophobie aufzunehmen. Länder wie Frankreich müssten sich ernsthaft überlegen, ob ihre Aussenpolitik vor dem immer komplexer werdenden sicherheitspolitischen Hintergrund noch zeitgemäss ist und ob es einen eskalierenden asymmetrischen Kleinkrieg islamischer Akteure nach dem Motte Frantz Fanons riskieren möchte: «Europa hat seine Pfoten auf unsere Erdteile gelegt, und wir müssen so lange auf sie einstechen, bis es sie zurückzieht.»